Kommen Sie zu Besuch. Die aktuellen Öffnungszeiten und Führungen finden Sie hier:
Die Angebote der Evangelischen-Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde finden Sie hier:


Kommen Sie zu Besuch. Die aktuellen Öffnungszeiten und Führungen finden Sie hier:
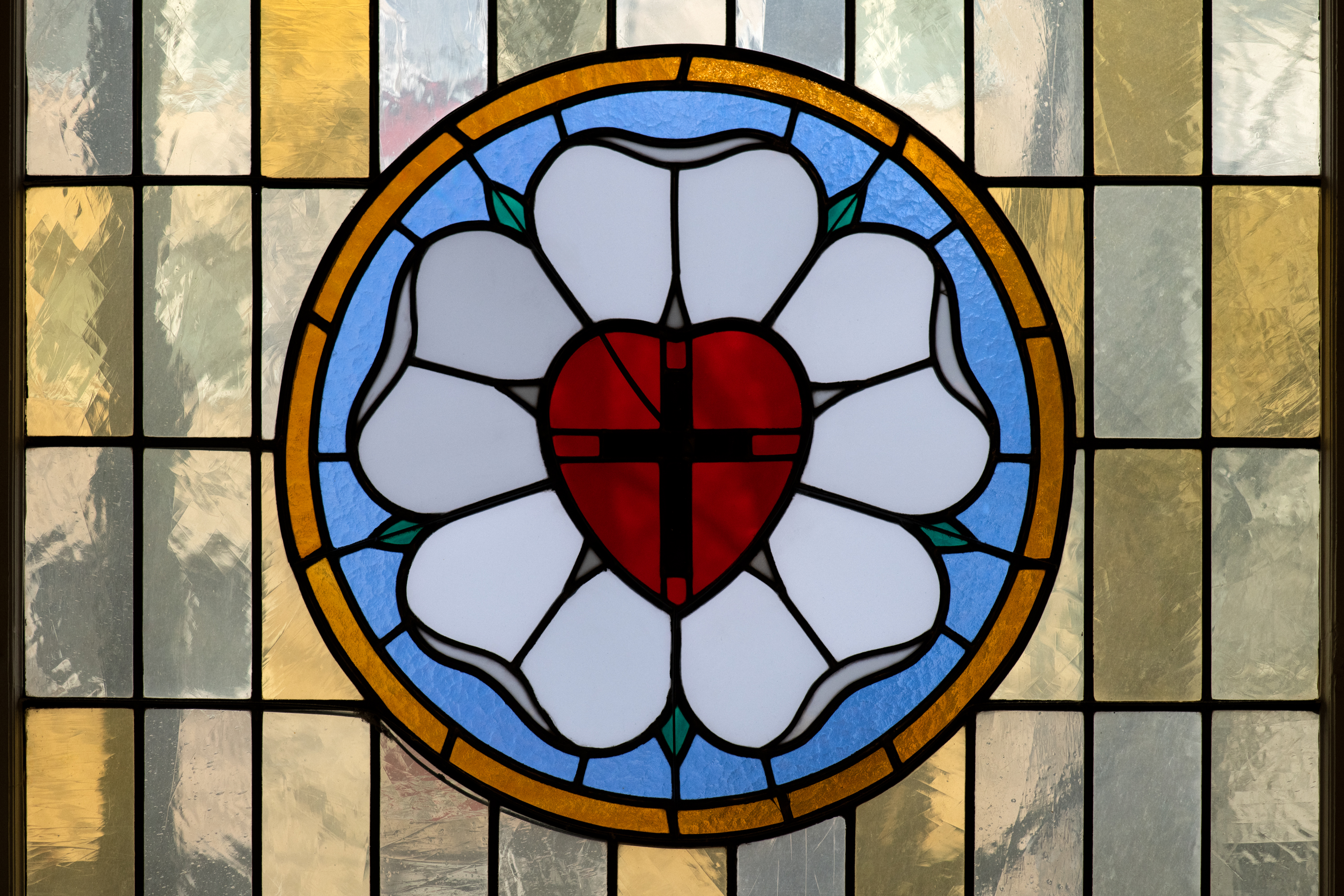
Die Angebote der Evangelischen-Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde finden Sie hier:

Die Stücke von Apollo5 haben einen starken Bezug zu Schottland oder Irland, aber es finden sich auch Ausflüge ins Italien der Renaissance, ins viktorianische England und nach Nordamerika.
Das Konzert des Vokalensembles in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche fand am 19.09.2025 statt und kann nun zusammen mit einem Beitrag zur Kirche und den anstehenden Instandsetzungsarbeiten des Denkmals bei Deutschlandfunk gehört werden.
Wir danken Deutschlandfunk und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die mit den Grundton-D-Konzerten Denkmale klanglich erlebbar werden lassen und damit einen wichtigen Beitrag zu deren Erhalt leisten. Das Konzert am 19.09.2025 wurde zugunsten des Gebäudeerhaltes der KWG initiiert.

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche erhält eine neue Zukunft: Im Rahmen eines umfassenden Sanierungsprojekts, das 2015 auf Initiative der Stiftung und des Deutschen Kulturrats begann, wird das historische Ensemble grundlegend restauriert und modernisiert. Neben der Sanierung der Eiermann-Bauten, der Modernisierung der Gebäudetechnik des gesamten Ensembles und Teilen der Beleuchtung steht die Erweiterung und Neukonzeption der Ausstellung im Alten Turm im Mittelpunkt.
Diese Publikation vereint einen Rückblick in die Geschichte und Zukunft des Ensembles, mit einem besonderen Fokus auf den Entwürfen für die Neugestaltung des symbolträchtigen Alten Turms der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.
Erhältlich im Shop der Gedenkhalle im Alten Turm oder auf Anfrage per E-Mail gegen eine Schutzgebühr von 16,50 Euro zzgl. Versand 3,20 Euro (inkl. 7% USt.).